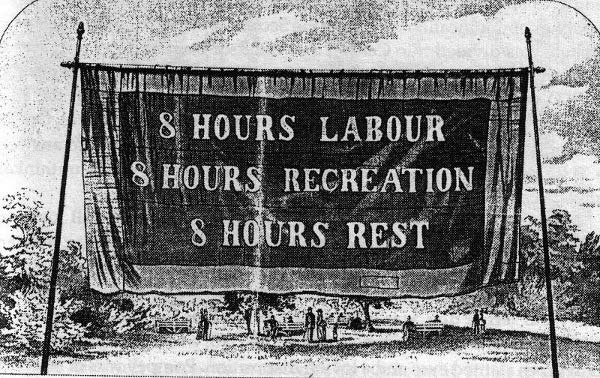
Die
Aktionen der Arbeiterbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert für
einen Acht-Stunden-Tag sind die Geburtsstunde des Ersten Mai, wie wir
ihn kennen: als berüchtigten Kampftag der ArbeiterInnen. Wie viel
Zeit die ArbeiterInnen dem Kapitalismus opfern müssen – darum ging
es häufig in der Geschichte der Arbeiterkämpfe. Auch die
Klassenkämpfe im bestehenden Kapitalismus sind in der Regel
Auseinandersetzungen um Lohn oder um Zeit. Im Wesentlichen sind beide
Formen Ausdruck desselben Interessenkonflikts, wenn auch jeweils
unter verschiedenen Prämissen: Lohnkämpfe sind meist nur dann
erfolgversprechend – und werden daher in organisierter Form oft nur
dann geführt –, wenn es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt und
die Preise gleichzeitig steigen. Kämpfe um Zeit – Neuregelung der
Arbeitszeiten anstelle der Löhne – scheinen dagegen einfacher
geführt werden zu können. Sie sind in vielen Variationen möglich,
auch individuell oder in kleineren Zusammenhängen.
„Zeit ist der Raum zur
menschlichen Entwicklung. Ein Mensch, der nicht über freie Zeit
verfügt, dessen ganze Lebenszeit – abgesehen von rein physischer
Unterbrechung durch Schlaf, Mahlzeiten usw. – von seiner Arbeit für
den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als ein Lasttier“.[1]
Was Karl Marx hier einfordert, ist Freizeit zur Entwicklung des
Proletariers über die Reproduktion hinaus. Das Sprichwort „Zeit
ist Geld“ trifft für die Seite des Kapitals vollkommen zu. Deshalb
führt es die Kämpfe um Zeit erbittert und kleinlich: um jede
Minute, die ihm vertraglich die Arbeitskraft zusteht, wie auch
darüber hinaus. Wen wundert’s, ist doch die Arbeitszeit die
einzige Konstante, die sich im Wert aller produzierten Waren
wiederfindet: „Geld als Wertmaß ist notwendige Erscheinungsform
des immanenten Wertmaßes der Waren, der Arbeitszeit“.[2]
Das heißt: Der Wert einer Ware wird nach der gesellschaftlich
notwendigen Arbeitszeit bemessen. Möglichst viel der gesamten
verfügbaren Zeit der ArbeiterInnen ökonomisch nutzbar zu machen,
ist zentral für den Klassenkampf von oben.
Für ArbeiterInnen ist nur die Arbeitszeit Geld.
Reproduktionszeit und darüber hinausgehende Freizeit ist uns mehr
als das. Zeit ist plötzlich unterteilt in die eigene Zeit und die
des Unternehmers; und „der auf Geld reduzierte Wert der Zeit wird
vorherrschend“.[3] Gerade in Rezessionszeiten geht es
oftmals nur um das Mehr an Zeit für die ArbeiterInnen, etwa die
„gerechte“ Verteilung der Lohnarbeit zwischen Erwerbslosen und
Erwerbstätigen. Aber im Idealfall ist auch die Forderung nach mehr
Freizeit an Lohnforderungen gekoppelt.
Die
Enteignung der Zeit
E.P. Thompson hat dargestellt, welch gewalttätiger
Kraftaufwand seitens des Kapitals in der Geschichte nötig war, um
eine funktionierende Arbeitsdisziplin herzustellen, ArbeiterInnen
also dazu zu bringen, pünktlich zu kommen, nicht zu früh zu gehen,
den geläufigen Blauen Montag nicht zu begehen usw. Der Kampf um Zeit
äußerte sich hierbei als Kampf gegen christliche Feiertage (und ihr
weniger christliches Begehen) sowie in der Einführung der Uhr als
Massenprodukt. Die Basisinnovation „Eisenbahn“ ist auch unter
diesem Aspekt zu betrachten: „Eisenbahnen sind die großen Erzieher
und Beaufsichtiger des Volkes, was das Einlernen und Einhalten der
genauen Uhrzeit angeht“[4] stellte der US-amerikanische
Politiker William F. Allen 1883 fest.
Die Zeit, die für Arbeit, und die Zeit, die für das
Leben investiert wurde, machte vor der Ära des Kapitalismus meist
keinen Unterschied – es war auch nicht nötig, sie zu messen. Von
einem marktwirtschaftlichen Standpunkt aus musste das als
Verschwendung und Disziplinlosigkeit aufgefasst werden. Zahlreiche
Sprichwörter tun den implementierten Kulturwandel kund: „Der frühe
Vogel fängt den Wurm“, „Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben“, „Zaudern ist der Dieb der Zeit“, bis hin zu dem
moderneren „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“.
Der Uhr und der Pünktlichkeitslehrerin Eisenbahn
folgten „Kontrollkarte, Aufseher, Denunzianten und Fabrikstrafen“,
schließlich dann „Arbeitsteilung und Arbeitsüberwachung,
Geldstrafen, Glocken- und Uhrzeichen, Geldanreize, Predigten und
Erziehungsmaßnahmen, Abschaffung von Jahrmärkten und
Volksbelustigungen“.[5] Dabei war es anfangs keineswegs
gewünscht, dass ArbeiterInnen die Uhrzeit auch kennen. Denn die
Uhren des Unternehmertums gingen schon immer etwas anders als die der
ArbeiterInnen: Morgens gehen sie vor, abends gehen sie nach. Das ist
keineswegs allegorisch zu verstehen. Thompson zitiert einen Arbeiter
der 1830er Jahre: „So läutet die Glocke zum Weggehen zwei Minuten
zu spät, aber zwei Minuten zu früh müssen die Arbeiter wieder da
sein. Gewöhnlich waren die Uhren so eingerichtet, dass der
Minutenzeiger, wenn er den Schwerpunkt überschritt, gleich drei
Minuten fiel und ihnen statt 30 Minuten nur 27 ließ“.[6]
Während es in der Frühzeit des Kapitalismus beim
Kampf um Zeit darum ging, die variable Zeitrechnung der
SubsistenzarbeiterInnen – die sich z.B. an der See nach Ebbe und
Flut richtete – durch die kapitalistische Zeitwahrnehmung zu
ersetzen, können wir heute davon ausgehen, dass diese in der
westlichen Welt vollkommen verinnerlicht wurde. „Der ersten
Generation Fabrikarbeiter wurde die Bedeutung der Zeit von ihren
Vorgesetzten eingebläut, die zweite Generation kämpfte in den
Komitees der Zehn-Stunden-Bewegung für eine kürzere Arbeitszeit,
die dritte kämpfte für Überstunden- und Feiertagszuschläge. Sie
hatten die Kategorien ihrer Arbeitgeber akzeptiert und gelernt,
innerhalb dieser Kategorien zurückzuschlagen“.[7]
Seinerzeit wurde die Zeit ursprünglich akkumuliert und erst zu einem
Gegenstand des Kapitalismus gemacht. Die Durchsetzung dieser
Zeitdisziplin war eine durchaus gewaltsame.[8] Heute ist
die Zeit integraler Bestandteil des Kapitalverhältnisses: „In der
reifen kapitalistischen Gesellschaft muss die gesamte Zeit
vollständig verbraucht, vermarktet, nützlich eingesetzt
werden; es ist anstößig, wenn die Arbeitskräfte bloß ‚die Zeit
verbringen’.“[9] Klassenkämpfe sind so ein Ringen um
Zeit zwischen Kapital und lebendiger Arbeit.
Arbeitszeit: Weniger
ist Mehr
Während Lohnkämpfe heute meist
kollektiv und publik geführt werden – vorwiegend in Form von
Tarifverhandlungen und legalen, tariflichen Streiks –, bleiben die
Kämpfe um Zeit oft unsichtbar. Das war nicht immer so. Gerade der
Erste Mai als Kampftag der ArbeiterInnen basiert aus einem
Klassenkampf um Zeit von unten. Wie akut und für das Kapital und
Bürgertum durchaus bedrohlich eine solche Arbeitszeitverkürzung
war, wird durch die Weigerung der deutschen Sozialdemokratie
deutlich, Aktionen zum Ersten Mai mitzutragen: Am 1. Mai 1890 sollte
es nach Beschluss des Sozialistenkongresses von Paris 1889 zu einem
Aktionstag kommen. Die gesetzten Ziele sollten jedoch nicht etwa
durch einen Generalstreik, sondern letztlich durch Verhandlungen
erreicht werden. Vor allem die deutsche Sozialdemokratie lehnte einen
Generalstreik vehement ab. Die Resolution der SPD zum 1. Mai wurde
jedoch als Aufruf zum Streik missverstanden. Dass die SPD-Funktionäre
der entstehenden Dynamik dann entgegentraten, wurde ihnen von Basis
und von den Gewerkschaften vielerorts übel genommen. Während nun
die lokalistischen Gewerkschaften (später: FVDG) und die
sozialdemokratische Opposition der „Jungen“ für den
Generalstreik am 1. Mai eintraten, sammelte die SPD relativ erfolglos
Unterschriften.
Die Drückebergerei der
Sozialdemokraten ging noch weiter: Als 1891 von der Zweiten
Internationale beschlossen wurde, am 1. Mai die Arbeit niederzulegen,
verschob die SPD den Aktionstag in Deutschland stattdessen auf den
ersten Sonntag im Monat. Mit immer wieder neuen Ausreden versuchte
die SPD im Folgenden, Arbeitsniederlegungen am Ersten Mai zu
verhindern: Die ökonomische Lage spräche dagegen, oder die
„gegenwärtige Arbeitslage“. Dennoch fanden jedes Jahr Streiks
statt. Die Streikenden hätten allerdings der finanziellen und
organisatorischen Unterstützung der Gewerkschaften bedurft, denen
waren sie aber – unter dem Eindruck der ausgegebenen Generallinien
– ein Dorn im Auge. Letztlich lehnten diese, abgesehen von den
lokalistischen und syndikalistischen Organisationen, auch 1914
offiziell den Generalstreik ab.[10]
In der jüngeren Geschichte finden wir als prominente
Beispiele die Durchsetzung der sogenannten „Steinkühlerpause“
und den Kampf um die 35-Stunden-Woche. Die „Steinkühlerpause“,
benannt nach dem damaligen IG-Metall-Verhandlungsführer Franz
Steinkühler, legt seit 1973 eine zusätzliche Pause für
AkkordarbeiterInnen im baden-württembergischen Flächentarifvertrag
der IG Metall fest und konnte damals im Zuge des Streiks für den
Lohnrahmentarif II durchgesetzt werden. Der Kampf um die
35-Stunden-Woche wiederum, insbesondere ausgetragen von der IG Metall
in den 1980er Jahren, erreichte seinen Höhepunkt 1984 mit dem Streik
einer viertel Million Metall-ArbeiterInnen. Die Vorgeschichte setzt
jedoch weit früher an: Seit 1955 wurde für den arbeitsfreien
Samstag unter dem bekannten Motto „Samstag gehört Vati mir“
gekämpft. In den gewerkschaftslinken Debatten der 1970er Jahre wurde
dann die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung aufgestellt. Die
35-Stunden-Woche erreichte die IG Metall erst 1995. Die
„Steinkühlerpause“ wurde von den Unternehmern immer wieder in
Frage gestellt[11] und die 35-Stunden-Woche stand stets
und steht auch momentan auf wackeligen Füßen. Gewissermaßen wird
dieses Konzept in der aktuellen Krise durch die Kurzarbeit ersetzt –
was völlig fehlt, ist natürlich der „volle Lohnausgleich“. Zwar
gilt dies vor allem in Branchen, die die Wirtschaftskrise besonders
hart trifft, aber generell lässt sich feststellen, dass der
gegenwärtige Trend zur Arbeitszeitreduzierung nicht bedeutet, alle
weniger arbeiten zu lassen, sondern einige gar nicht und andere
möglichst viel.
Im Gegensatz zu diesen prominenten Beispielen gelangt
die alltägliche Widerständigkeit gegen das kapitalistische
Zeitmanagement kaum in die Öffentlichkeit: Krankfeiern, Pausen
überziehen, Streits um Pausenlängen und sogar das „unabsichtliche“
Verschlafen – ein im wahrsten Sinne unbewusste Form des
Klassenkampfes.[12]
Vom
Microchip zur neoliberalen Zeiterfassung
 Ganz im Gegensatz dazu die Kapitalseite: Hier wird sehr
Ganz im Gegensatz dazu die Kapitalseite: Hier wird sehr
bewusst alles getan, um mindestens jede Minute der eingekauften
Arbeitszeit „effektiv“ zu nutzen. Mittlerweile hat sich eine
ganze Branche diesem Bedürfnis zugewendet. Karl Heinz Roth
beschreibt in Die globale Krise den Mikrochip – neben dem
Container – als Basisinnovation des vergangenen kapitalistischen
Zyklus. Basisinnovationen kommt „die Kraft zu, das in der
Krisenperiode angehäufte Sparkapital der streikenden Investoren und
auf die Straße geworfenen Arbeitskräfte wieder einzusammeln und auf
jene neuen und hochprofitablen Wirtschaftszweige zu lenken, aus denen
neue Produkte hervorgehen“.[13] Der Mikrochip eröffnete
aber als Innovation nicht nur das Zeitalter der Computertechnologie
und damit entsprechender neuer Märkte, er ermöglichte auch ganz
neue Arbeitszeitmessungen. Zum Beispiel wurden mit dem „Methods
Time Measurement“ (MTM) „die elementaren Hand-, Finger- und
Blickfunktionen durchschnittlich geübter Arbeiterinnen und Arbeiter
entschlüsselt, mit ihren Körper- und Fußbewegungen korreliert und
zu Grundbewegungen verdichtet, die innerhalb standardisierter
Zeittakte – oftmals nur wenige Sekunden – zu absolvieren
waren“.[14]
Ursprünglicher Sinn solcher Messungen war die
Übertragung der Arbeitsschritte auf Computersysteme, um Roboter
entsprechend programmieren zu können. Kollateraler Nutzen für das
Kapital war aber auch, den ArbeiterInnen sekundengenau vorhalten zu
können, wie lange ein bestimmter Arbeitsschritt exakt zu dauern hat.
Das ist an sich schon problematisch genug. Seltsam wird diese
Messmethode, die sich auf den gesamten Arbeitssektor ausgebreitet
hat, aber vor allem dann, wenn sie auf geistige und humanitäre
Tätigkeiten ausgeweitet wird. Die Zerlegung der Zeit in möglichst
kleine Einheiten, die dann entsprechend genauestens geplant werden
können, mag z.B. auch Studierenden bekannt vorkommen.
„Modularisierung“ schimpft sich diese Einteilung im
Bologna-Prozess. In der Bildung sind aber keineswegs nur Studierende
von einer solchen Modularisierung betroffen. Dass die Planung und
Erfüllung der Studienmodule für Bachelor- und Master-Studiengänge
für DozentInnen ebenso belastend ist wie für Studierende, dürfte
nicht überraschen; dass die Messbarkeit zunehmend auch den
sogenannten „Unterbau“ (HausmeisterInnen, SekretärInnen,
BibliothekarInnen usw.) betrifft, dagegen schon. Soweit nicht ersetzt
durch Ein-Euro-JobberInnen (HausmeisterInnen) oder elektronische
Systeme (BibliothekarInnen), wird von ihnen mittlerweile eine Arbeit
ähnlich derjeniger solcher Systeme verlangt.
Regelrecht pervers gestaltet sich die Zeitbemessung im
Bereich der Pflege. Das beginnt schon bei den „DRG“, dem neuen
Zauberwort der Branche. Die „Diagnosis Related Groups“ sind seit
2004 als verpflichtendes Entgeldsystem in deutschen Krankenhäusern
eingeführt. Anhand der Diagnose, der ein bestimmter
Behandlungsaufwand zugerechnet wird, werden PatientInnen in
ökonomisch gleich teure Gruppen sortiert, und diesen entsprechend
zahlen die Krankenkassen. Getoppt wird dies nur noch von der
„Modularisierung“ der Pflegearbeiten. Wie lange der Einkauf für
eine betreute Person, die tägliche Dusche oder das Zubereiten einer
Mahlzeit dauert, ist minutengenau geregelt – und keine Minute mehr
wird von der Pflegeversicherung bezahlt. Überflüssig zu erwähnen,
dass der Kostendruck über die ArbeiterInnen letztlich auf die
Pflegefälle abgewälzt wird. Wurden auch hier „elementare
Funktionen“ „durchschnittlicher“ ArbeiterInnen gemessen?
Jedenfalls hat niemand die Entfernungen zum nächsten Supermarkt
gemessen[15].
Complete
Control
Exakte Messungen – das scheint der Kern der heutigen
Akkumulation von Zeit im kapitalistischen Sinne zu sein. Und das war
schon die fundamentale Idee des Taylorismus. „Mittels Zeit- und
Ablaufstudien sollte das Arbeiterwissen in ein kodifiziertes Wissen
verwandelt und dem Management zur Verfügung gestellt werden; den
Lohnarbeitern sollte es nur noch in Form streng vorgeschriebener
Zeit- und Bewegungsabläufe begegnen“.[16] Ein Beispiel
dafür ist das Zeiterfassungssystem der Hamburger Firma D+S Europe
mit dem bezeichnenden Namen „Intraday Complete Control“ (ICC):
Die totale Kontrolle über die ArbeiterInnen ist das schon im Namen
verdeutlichte Ziel. ICC wird z.B. von der Verlagsgruppe Bauer und den
zehn hauseigenen Callcentern von D+S genutzt. Allerdings bei Weitem
nicht widerstandslos. So befindet sich das System in Münster bereits
zum zweiten Mal in einer Testphase, da der Betriebsrat von D+S
Münster nach massivem Protest der ArbeiterInnen für die
Unterbrechung des ersten Testlaufs gesorgt hat. Aktiver Widerstand
gegen die komplette Kontrolle findet auch dadurch statt, dass z.B.
Pausen einfach nicht eingetragen werden oder aber das Ausloggen nach
Feierabend „vergessen“ wird. ICC ist fehleranfällig, da die
ArbeiterInnen das System selbst bedienen müssen und damit
phantasievoll umgehen können.
Während ICC die Arbeitszeit exakt erfassen will, ist
das Programm bei der Freizeit nicht so pingelig: Sollte über die
geplante Arbeitszeit hinaus gearbeitet werden, erfasst das System
diese Zeit nicht mehr. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Das
Kapital will in der Tat nur die bezahlte Arbeitszeit exakt erfassen,
um möglichst viel Mehrwert aus dieser zu schlagen. Aus genau
demselben Grund wird die unbezahlte Freizeit – in der sich jedoch
die ArbeiterInnen bitteschön auch mit Betriebsangelegenheiten
befassen sollen (das sehen wir bei der FAU ja auch so, aber meinen
das ganz anders) – eben nicht gemessen. „Dies scheint vor
allem möglich durch die Mobilisierung betriebsgemeinschaftlicher
Mentalitäten, die eine ständige Bereitschaft [also auch in der
Freizeit] zur Selbstaktivierung hervorbringen“.[17]
Detlef Hartmann beschreibt diese Seite des Prozesses so: „Die
Unternehmen … bewerten subjektive Potenziale, die Fähigkeit und
Bereitschaft, sich selbst vorbehaltlos zu unterwerfen, zu offenbaren,
einzubringen, in Dienst zu stellen und sich selbst zu organisieren,
zu rationalisieren, zu optimieren. Sich, das heißt: auch die
Familien, die sozialen Beziehungen, das eigene Leben“.[18]
Kurz: Mit allen möglichen Formen von Anreizen und Druck sollen die
ArbeiterInnen dazu gebracht werden, die Reproduktionszeit und ihre
darüber hinaus gehende Freizeit mehrwertschöpfend in den Dienst des
Kapitals zu stellen. Beispielhaft lässt sich der ursprünglich links
besetzte Begriff des „lebenslangen Lernens“ nennen, der
neoliberal in eine lebenslange Pflicht zur beruflichen Weiterbildung
im und neben dem Broterwerb uminterpretiert wurde.[19]
Auch hier spielt die Basisinnovation Mikrochip unterschwellig die
entscheidende Rolle: „Es liegt auf der Hand, dass der Griff in die
subjektiven Ressourcen ohne die IT-Technologien überhaupt nicht
möglich und gar nicht erst versucht worden wäre“.[20]
Hartmann sieht in diesen Prozessen der
Selbstinwertsetzung den Versuch, aus der Krise des keynesianischen
Modells seit den frühen 1970er Jahren zu entkommen.[21]
In diesem Sinne ist anzunehmen, dass auch die gegenwärtige
Transformation der proletarischen Mentalitäten einem Entkommen aus
der aktuellen Krise dienen soll. Und dies weist womöglich darauf
hin, dass der Kampf um Zeit in eine neue Phase tritt, indem das
Kapital die Zeit über die reine Arbeitszeit hinaus akkumulieren
will.
Die
Module spielen verrückt
Immer noch geht es im
Klassenkampf um Minuten und sogar Sekunden. Die durch das
Bildschirmarbeitsplatzgesetz geregelten Bildschirmpausen etwa sind
vielen Call-Centern immer noch ein Dorn im Auge. Die Frage, ob 30
Sekunden Pause zu einer Minute auf- oder abgerundet werden, ist hier
durchaus arbeitskampfrelevant und beschäftigt ganze Arbeitsgerichte.
Einige Unternehmen, z.B. der Osnabrücker Call-Center-Konzern buw,
vermeiden diese Pausen dadurch, dass sie die Bildschirmarbeit durch
andere Arbeiten (z.B. Briefe eintüten) unterbrechen – ungeachtet
dessen, dass ein solcher Wechsel in den Arbeitsarten dann wesentlich
länger sein sollte als die vier- bis siebenminütige Pause.
Der Kampf um Zeit geht aber wesentlich weiter. Er
tangiert auch das Prinzip des „Forderns und Förderns“ unter
Hartz IV, und zwar in dem Sinne, dass auch Erwerbslose nicht über
ihre Zeit frei verfügen können sollen, des weiteren in der Frage um
die Länge der Ausbildungszeit[22] oder in der Frage, ab
wann man Rente erhält. Denn dem Kapital geht es darum, „die
Gesamtheit der gesellschaftlichen Zeitordnungen der heteronomen Logik
der Kapitalverwertung zu unterwerfen“.[23] Carlo
Vercellone benennt Projektmanagement, Druck durch Kunden und Zwang
durch Prekarität als Elemente der Durchsetzung dieser erneuerten
kapitalistischen Zeitordnung. Seinen Schluss daraus werden viele aus
eigener Erfahrung unterschreiben können: „Das Kapital versucht,
gratis zu profitieren, indem es Löhne, die auch die … im
offiziellen Arbeitsvertrag unerfasst bleibende Arbeitszeit
berücksichtigen, verweigert“.[23] Detlef Hartmann
folgert daraus, dass die aktuellen sozialen Auseinandersetzungen nur
im Kontext solcher „Formen der Knechtung, ihre[r]
sozialtechnische[n] Erneuerung und Verfeinerung“ zu verstehen sind.
[24]
Anders gesagt: Der Kampf für unbezahlte Ausbildung und
Bildung – sei es nun Kindergarten oder Hochschule –, der Kampf
gegen eine Verkürzung der Rentenzeit, der Kampf für mehr Freizeit,
das alles sind Elemente des Klassenkampfes. Die Bildungsproteste des
Jahres 2009 sind dabei ebenso beachtenswert wie neue Kampfmethoden in
bisher recht arbeitskampfarmen Branchen, wie etwa der „Scheißstreik“
im Bereich der persönlichen Assistenz.[25] Ebenso wie die
Überziehung einer Pause, das Schwänzen eines Seminars genauso
klassenkämpferische Elemente haben können wie ein Streik.
Oftmals finden diese Klassenkämpfe individualisiert
statt. Dabei, und das ist eine zentrale Idee des Syndikalismus,
hätten sie kollektiv mehr Chancen auf Erfolg. „[D]ie Menschen
können arbeiten, wenn sie sich zusammentun & so können sie auch
trödeln“, berichtete der Bauer Robert Loder über seine
Untergebenen schon zwischen 1610 und 1620.[26] Das muss
und soll nicht immer die soziale Revolution von jetzt auf gleich
sein, der Kampf um die tägliche Verbesserung ist ebenso relevant:
„Wenn wir … die Wahl zu treffen haben zwischen acht
Stunden Arbeitszeit und zehn Stunden Arbeit, … so entscheiden wir
uns natürlich für die acht Stunden und den besten Lohn. Wohl wissen
wir, dass damit an der Existenz der Lohnsklaverei nichts geändert
wird, der wir auch weiterhin unterworfen sind. Aber wir haben unsere
Entscheidung unter der Erwägung getroffen, dass zwei Stunden weniger
Sklaverei … eine Errungenschaft sind, die kein vernünftiger Mensch
zu unterschätzen weiß“.[27] Oder, wie es die FAU 80
Jahre später ausdrückte: Ob fünf Minuten mehr Pause oder
Weltrevolution – Wir kriegen nur, wofür wir kämpfen!
Teodor Webin
Anmerkungen
[1]
Marx, Lohn, Preis, Profit, MEW Bd. 16, S. 144.
[2] Marx, Das Kapital, MEW Bd.
23, S. 109.
[3] Vgl. Thompson, „Zeit,
Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus“, in Holloway &
Thompson, Blauer Montag, S. 19-72.
[4] Caffentzis, George, „Der
Marxismus nach dem Untergang des Goldes“, in: Van der Linden &
Roth (Hg.), Über Marx hinaus, Berlin/Hamburg 2009, S. 467.
[5] Thompson, S. 52 u. 62.
[6] Ebd., S. 57.
[7] Ebd. Thompson merkt zudem an, dass
„das Zeitgefühl der Mutter von kleinen Kindern […] unvollkommen
[ist] und […] auf andere menschliche Gezeiten [achtet]. Sie hat
sich bislang noch nicht vollständig aus den Konventionen der
‚vor-industriellen’ Gesellschaft herausbewegt“; S. 48.
[8] Vgl. Marx, MEW Bd. 23. S. 765.
[9] Thompson, S. 63.
[10] Siehe dazu: Halfbrodt,
Achtstundentag und Erster Mai, Bielefeld 1997.
[11]
1996 wurde die „Steinkühlerpause“ auf die Fließbandarbeit
beschränkt. 2004 sprachen die Arbeitgeber der Metall-Industrie von
der „baden-württembergischen Krankheit“. Vgl. Beck, „1973 –
Steinkühlerpause erstreikt“,
www.labournet.de/diskussion/arbeitsalltag/az/steinkuehlerpause.html.
[12] Unter
Widerständigkeit verstehe ich dabei keineswegs nur den bewussten
Widerstand gegen kapitalistische Ausbeutung, sondern auch die
Widerständigkeit, die das Kapitalverhältnis impliziert: Das Kapital
muss sich immer mit lebendiger Arbeit ‚rumschlagen, die neu
diszipliniert und zugerichtet werden muss.
[13] Roth, Die
globale Krise, Hamburg 2009, S. 160. Den Begriff der
„Basisinnovation“ entlehnt Roth von Kondratieff, „Die langen
Wellen der Konjunktur“, in: Archiv für Sozialwissenschaften und
Sozialpolitik, Nr. 3 (1926), S. 573-609.
[14] Roth, S.
164. Roth beschreibt die MTM als „Ermittlung so genannter
Kleinstzeiten“.
[15] Und schon
gar nicht, ob dies auch der billigste ist und wie viel Geld die
betreute Person überhaupt hat. Richtig bizarr wird es dann, wenn die
Fallmanagerin der ARGE den Einkauf bei Lidl oder Aldi empfiehlt,
diese aber so weit weg sind, dass der Discounter für die Pflegekraft
nicht in der vorgegebenen Zeit zu erreichen ist.
[16] Vercellone,
Vom Massenarbeiter zur kognitiven Arbeit, in: Van der Linden &
Roth, S. 530.
[17] Roth, S.
165.
[18] Hartmann,
Revolutionäre Subjektivität, die Grenze des Kapitalismus,
in: Van der Linden/Roth, S. 219. Zur Kritik am Ansatz Hartmanns vgl.
die Buchbesprechung „Selbstunternehmerische Aktivierung“, in:
Wildcat, Nr. 86 (Frühling 2010), S. 73-6.
[19]
Vgl. dazu: Bildungssyndikat Münster, „Bildungspolitik vom Runden
Tisch. Intelligentes Humankapitalmanagement zum Wohle aller“,
Interhelpo, Nr. 10 (2001). Zu finden auf
www.fau.org/ortsgruppen/muenster.
[20]
Hartmann, S. 236.
[21] Vgl. ebd.,
S. 246.
[22] Z.B. durch
die Einführung von Langzeitstudiengebühren. Die SPD brüstet sich
im Wahlkampf nach wie vor gerne damit, Studiengebühren abschaffen zu
wollen und vergisst dabei, dass sie sie in mehreren Bundesländern
eingeführt hat. Die „Langzeitstudiengebühren“, also die
sanktionierte Begrenzung der Ausbildungszeit, gelten – zumindest
für die SPD – schon gar nicht mehr als Bezahlung für Bildung.
[23] Vercellone,
S. 550.
[24] Hartmann,
S. 250.
[25] Siehe die
Homepage www.jenseits-des-helfersyndroms.de. Vom 27. April bis zum
27. Mai 2009 versendeten Beschäftigte aus der ambulanten Pflege und
der persönlichen Assistenz Kotröhrchen an politisch und ökonomisch
Verantwortliche. Siehe auch das Interview mit einem Aktivisten, in
der Wildcat, Nr. 86 (Frühling 2010), S.50f.
[26] Thompson,
S. 45.
[27] Rocker, Der
Kampf ums tägliche Brot, Berlin 1924, S. 41.

